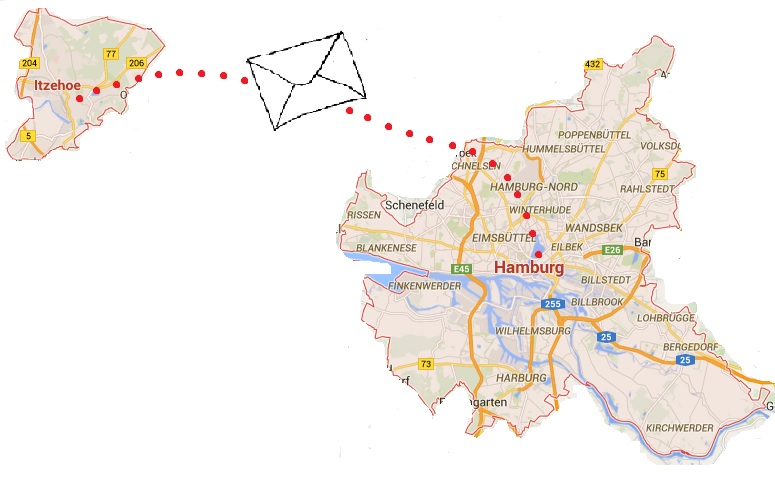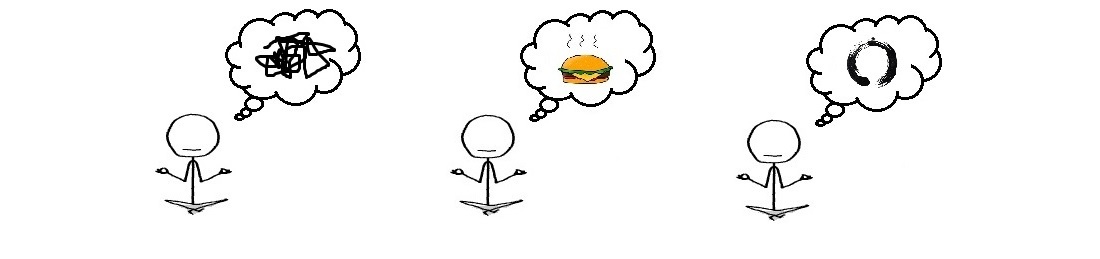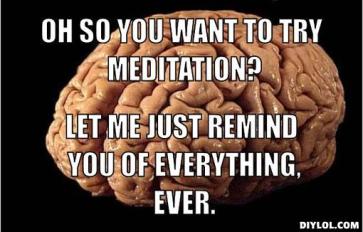Wie die Dorfies den Slang nach Hamburch brachten.
Als in der Kleinstadt groß gewordenes Landei muss man sich von seinem in Hamburch aufgewachsenem Großstadtfreund schon die eine oder andere Stichelei gefallen lassen. Abgesehen von einer bemerkenswerten Trinkfestigkeit, die einem auf dem Lande quasi in die Wiege gelegt wird, unterscheiden wir Dorfis uns scheinbar auch was unser Vokabular angeht von den Großstadtkindern. So ist es für einen Hamburger Jung wie meinen Freund quasi unmöglich zu einer Karotte Wurzel zu sagen. Natürlich sind mir Begriffe wie Karotte, Möhre und Mohrrübe geläufig, trotzdem wurde bei mir zu Hause stets Wurzel zu dem orangen, gesunden Ding gesagt. Nach regelmäßigen Diskussionen über Begrifflichkeiten und Redewendungen, von denen mein Freund der festen Überzeugung ist, dass ich sie frei erfunden hätte, trieb unser gemeinsamer Kurztrip nach Tallinn den kleinen Sprachkonflikt auf die Spitze.
Wir spazieren mit zwei Freunden durch die altertümliche Innenstadt von Tallinn (für alle, die es nicht wissen: Tallinn ist die Hauptstadt von Estland), als uns ein ziemlich verdroschen aussehender Kerl mit blau verfärbtem Augenlid entgegen kommt. „Na der hat aber ordentlich auf die Fresse gekriegt. Oder er hat sich so richtig abgepackt“, kommentiere ich sein unübersehbares Veilchen. „Was hast du gesagt?“, erwidert mein Freund darauf. Ich wiederhole den eigentlich unerheblichen Satz, so wie man es eben tut, wenn sein Gegenüber etwas akustisch nicht verstanden hat. Geduldig wie ich ja nun mal bin, wiederhole ich es auch ein zweites Mal, als mein Freund mich darum bittet. Bei der dritten Nachfrage komme ich mir dann aber doch ein wenig verarscht vor. „Das mit dem auf die Fresse kriegen habe ich schon verstanden“, sagt er schließlich mit ernster Miene, „aber dem, was du danach gesagt hast, kann ich beim besten Willen nicht folgen.“ An seinem Gesichtsausdruck kann ich festmachen, dass mein lieber Freund mich diesmal nicht auf den Arm nehmen will – er hat mich tatsächlich nicht verstanden. „Abpacken? Was meinst du damit?“ „Naja, abpacken eben“, entgegne ich, „so wie abmaulen“. Spätestens mit diesem Verb habe ich ihn dann völlig verwirrt. Seine Mutmaßung: Ein Wort in diesem Zusammenhang existiere überhaupt nicht. Seines Erachtens nach könne man allerhöchstens sich hinpacken sagen. „Abpacken kannst du ein Paket“, lacht er mich aus. Aber nach all den Seitenhieben, die ich aufgrund meiner ländlichen Wurzeln (ja, auch in diesem Zusammenhang kann man das Wort Wurzel benutzen), schon kassieren musste, will ich das diesmal nicht auf mir sitzen lassen! „Abbas! Lena!“, rufe ich die anderen Zwei, die uns voraus gegangen waren, ohne etwas von dem Gespräch mitbekommen zu haben. Siegessicher frage ich die Beiden nach der Bedeutung des Verbs sich abpacken. Doch zu meiner Überraschung ernte ich erneut ratlose Blicke und anschließendes Gelächter, als ich sie über die Bedeutung des Begriffs aufkläre. „So ist das nun mal mit euch auf’m Dorf. Das ist wie stille Post: In Hamburg entwickelt sich ein Slang und ihr benutzt dann das, was davon übrig bleibt“, flachst mich mein Freund. Sehr witzig! Ich verkneife mir einen dummen Spruch und erzähle daheim meinen treuen Kleinstadtfreunden davon. Auch hier erwartet mich Gelächter für die Story, wenigstens stoße ich diesmal auf allgemeines Verständnis. Schon merkwürdig, dass jeder einzelner Itzehoer, dem ich die Geschichte erzähle, sofort weiß was ich meine, während ein Hamburger mich nur anschaut, als würde ich Thai mit ihm sprechen. Sprachbarrieren existieren offenbar auch über Distanzen von gerade mal 60 km, denn so weit ist meine Heimatstadt Itzehoe vom schönen Hamburch entfernt. Das mit der stillen Post ist also gar nicht mal so abwegig. Und bei so vielen Menschen, die in der Großstadt leben, ist es auch ganz plausibel, dass da gewisse Wörter nicht richtig ankommen …